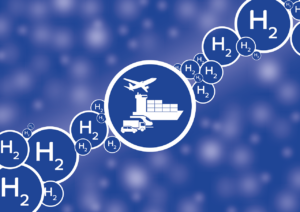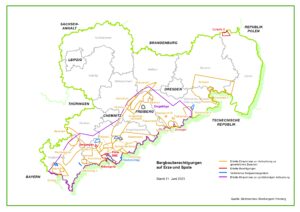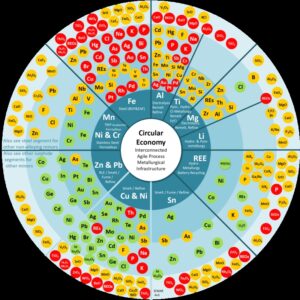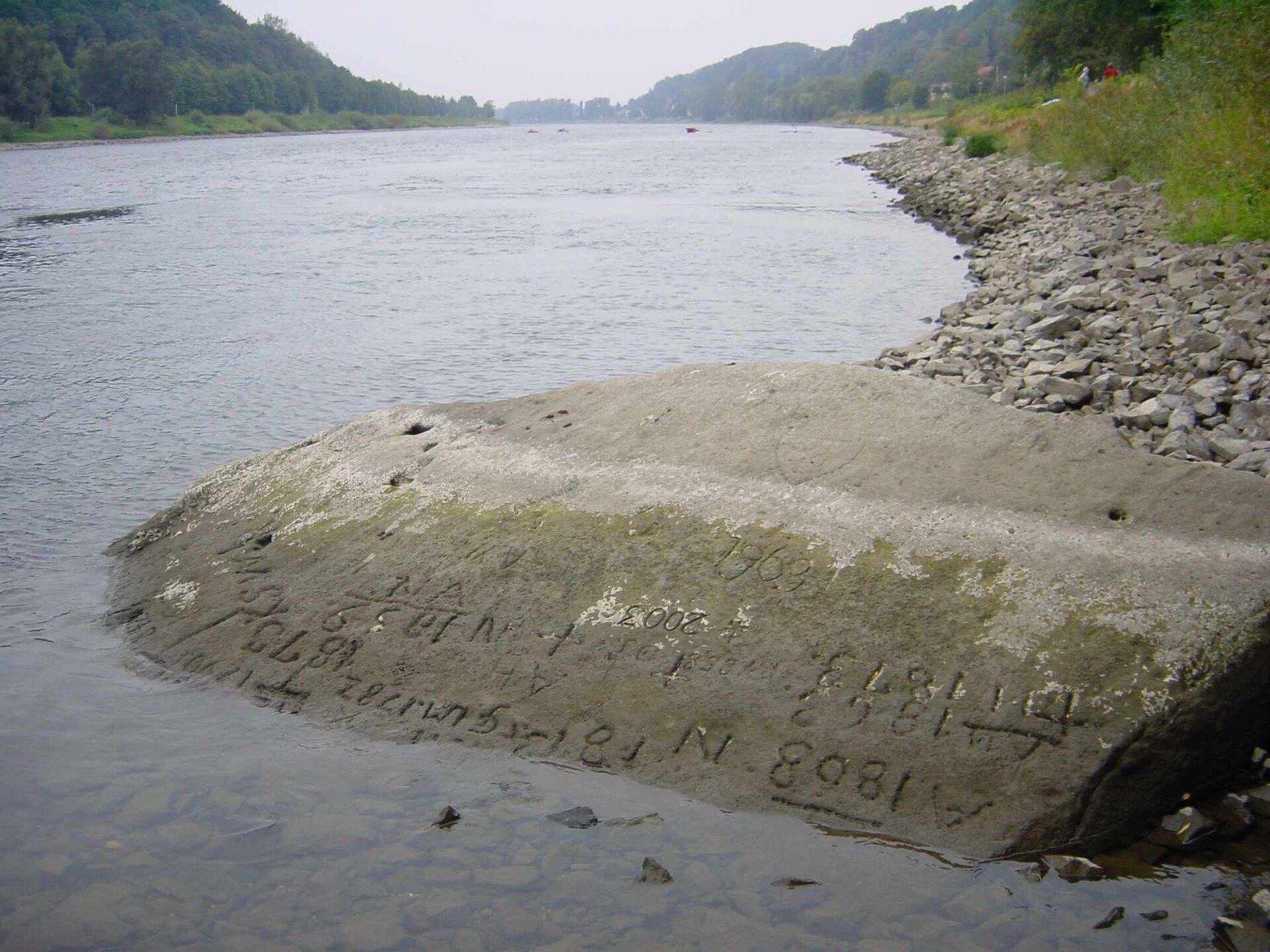Die Pläne für ein neues Bergwerk der Südharz Kali GmbH werden konkret. Dies ist u.a. zu sehen in der MDR-Dokumentation „Der Millionenschatz vom Ohmgebirge“ vom 19.03.2024 und auf der dazugehörigen MDR Webseite.
Das Unternehmen informiert auch auf seiner Website zu dem Vorhaben („Aktuelles aus der Südharz Kali GmbH“) und führte dieses Jahr eine Einwohnerversammlung in Bernterode durch. Neben der Präsentation dieser Versammlung ist dort ebenfalls ein Erläuterungsbericht zum Raumordnungsverfahren vorhanden.
Allerdings stoßen die Pläne zum einheimischen Bergbau nicht überall auf Gegenliebe. So berichtet der MDR u.a. „Pläne für Kali-Abbau: Was sagen die Bernterode-Anwohner dazu?“ vom 04. März 2024 und „Eichsfeld lehnt Pläne für Kali-Bergwerk in Bernterode ab“ vom 15.02.2023
Literatur im Bestand der Universitätsbibliothek sind zu folgenden Themen im Katalog zu finden:
Die Reports wurden u.a. von Ercosplan & K-Utec AG Salt Technologies erstellt/begeleitet.
Weitere Lagerstätten-Fakten sind auf der Webseite der Südharz Kali GmbH unter nachzulesen, sowie in unserem Blogbeitrag „Südharz Kali GmbH: noch in 2022 Standortwahl…“ von 4. Mai 2022.
 Unter
Unter